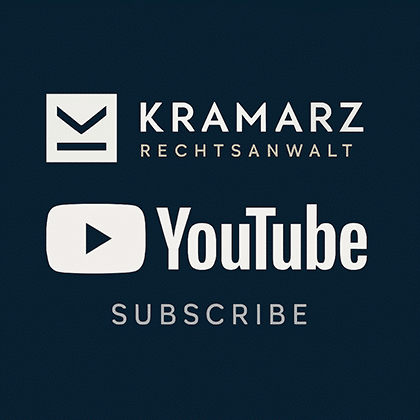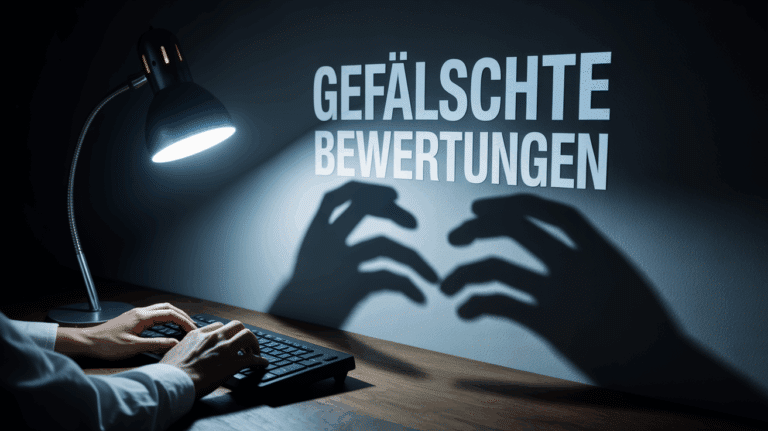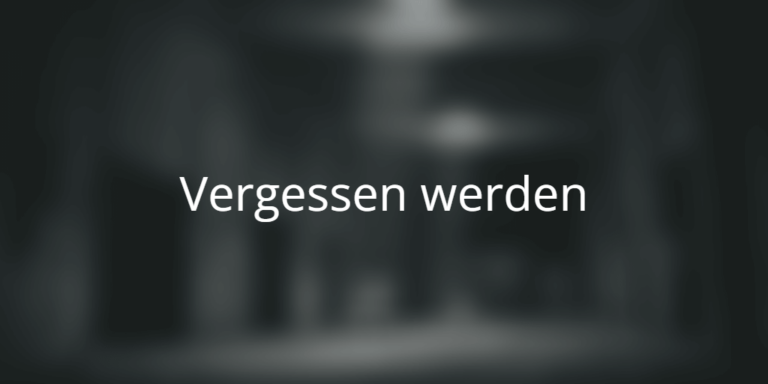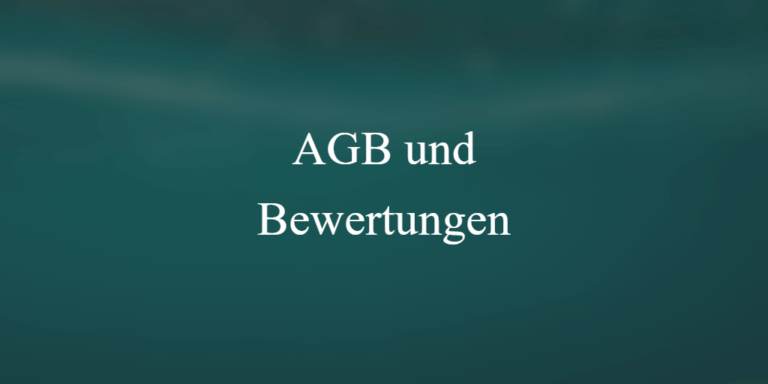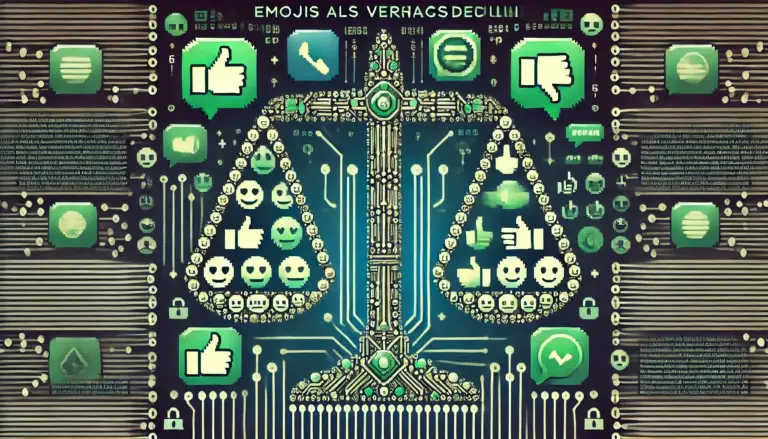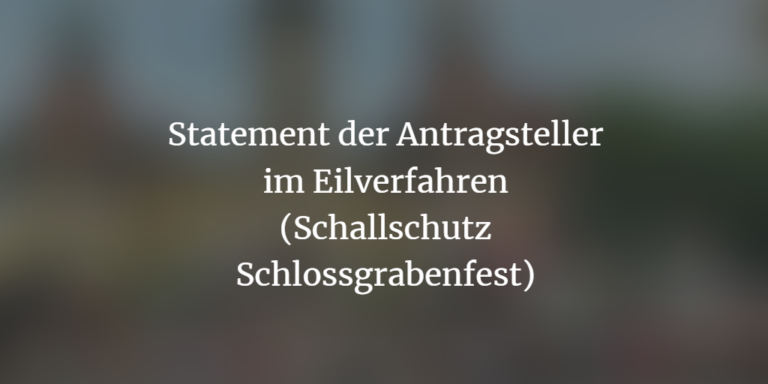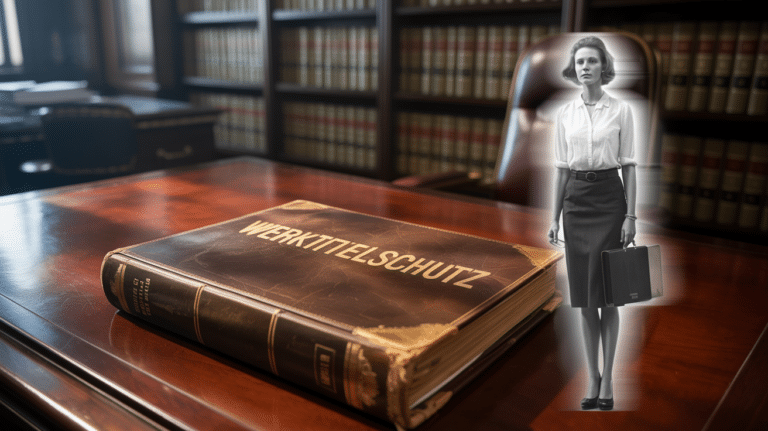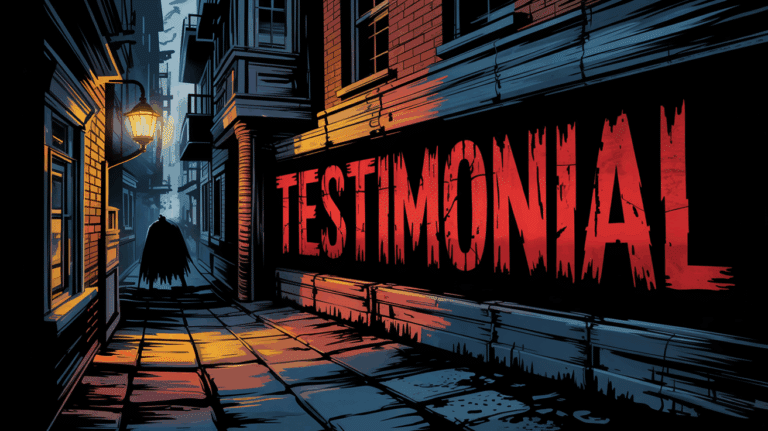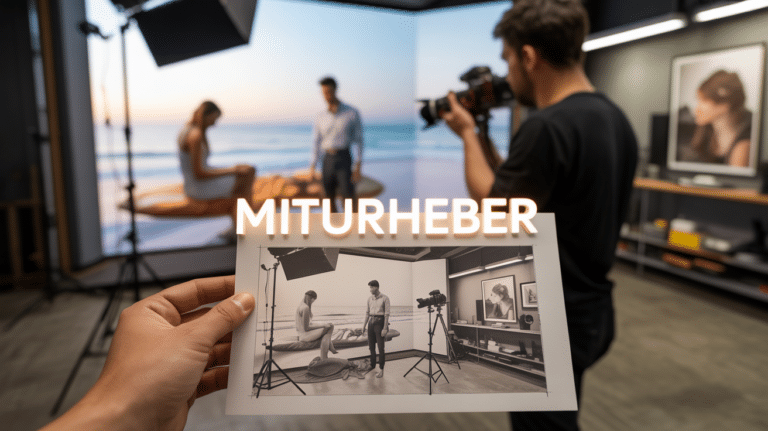Der Digital Services Act (DSA) der Europäischen Union hat die Spielregeln für Online-Plattformen grundlegend verändert. Ein zentrales Element ist das Verfahren zur Meldung rechtswidriger Inhalte. Doch müssen Nutzer dafür zwingend die von den Plattformen bereitgestellten Meldesysteme verwenden? Eine aktuelle Entscheidung des Kammergerichts Berlin (Beschluss vom 25.08.2025, Az. 10 W 70/25) bringt nun wichtige Klarheit und stärkt die Rechte der Nutzer erheblich.
Worum ging es in dem Fall?
Der Fall, der dem Kammergericht vorlag, ist für viele Nutzer von Social-Media-Plattformen und anderen Online-Diensten von großer Bedeutung. Ein Nutzer wollte eine Persönlichkeitsrechtsverletzung melden, nutzte dafür aber nicht das von der Plattform nach Artikel 16 des DSA eingerichtete, standardisierte Meldeverfahren. Stattdessen wählte er einen anderen Weg der Kontaktaufnahme.
Die Vorinstanz, das Landgericht Berlin II, hatte den Antrag auf eine einstweilige Verfügung zunächst zurückgewiesen. Die Begründung: Andere Formen der Meldung, wie zum Beispiel ein anwaltliches Schreiben, seien ungeeignet, um der Plattform die notwendige Kenntnis von der Rechtsverletzung zu verschaffen. Der Nutzer müsse sich an das vorgegebene Verfahren halten.
Die wegweisende Entscheidung des Kammergerichts Berlin
Das Kammergericht Berlin hob diese Entscheidung auf und stellte klar: Nutzer sind nicht gezwungen, das von einer Online-Plattform nach Artikel 16 DSA eingerichtete Meldeverfahren zu nutzen.
Diese Entscheidung ist ein klares Bekenntnis zur Wahlfreiheit und zum Verbraucherschutz. Die Richter machten deutlich, dass der Digital Services Act zwar die Plattformen verpflichtet, ein einfaches und zugängliches Meldesystem bereitzustellen, den Nutzern daraus aber keine Pflicht erwächst, ausschließlich diesen Kanal zu verwenden.
Die Begründung des Gerichts im Detail
Das Gericht stützte seine Auslegung auf mehrere überzeugende Argumente:
Wortlaut des Gesetzes: Artikel 16 DSA richtet sich an die Anbieter von Hostingdiensten. Er legt ihnen eine Pflicht auf, ein Verfahren einzurichten. Eine Verpflichtung für die Nutzer, dieses dann auch zu verwenden, lässt sich dem Gesetzestext nicht entnehmen.
Sinn und Zweck: Das Meldeverfahren soll den Nutzern eine leichte Möglichkeit zur Meldung verschaffen, sie aber nicht in ihren Wegen beschränken. Der DSA ist stark vom Verbraucherschutzgedanken geprägt und soll Rechte erweitern, nicht einengen.
Alternative Meldewege sind zulässig: Ein anwaltlicher Schriftsatz oder eine qualifizierte E-Mail sind ebenso geeignet, um eine Plattform über rechtswidrige Inhalte in Kenntnis zu setzen. Die pauschale Ablehnung solcher Meldungen durch die Vorinstanz war unzutreffend.
Es ist jedoch wichtig zu verstehen: Wer einen alternativen Meldeweg wählt, trägt das Risiko, dass die Meldung unzureichend ist. Die Mitteilung muss so präzise und begründet sein, dass die Plattform die Rechtswidrigkeit ohne eine eingehende juristische Prüfung erkennen kann.

Was bedeutet das für die Praxis?
Diese Entscheidung hat erhebliche praktische Auswirkungen. Plattformen können sich nicht mehr darauf zurückziehen, nur Meldungen zu bearbeiten, die über ihr internes System eingehen. Eine qualifizierte Meldung per E-Mail oder durch einen Rechtsanwalt muss ebenfalls bearbeitet werden und kann die sogenannte Störerhaftung des Anbieters auslösen.
Für Nutzer bedeutet dies mehr Flexibilität und Sicherheit. Insbesondere in komplexen Fällen oder bei schweren Rechtsverletzungen ist die Einschaltung eines spezialisierten Rechtsanwalts oft der bessere Weg, um den Sachverhalt präzise darzulegen und den Druck auf die Plattform zu erhöhen.
Fazit und anwaltliche Unterstützung
Das Urteil des Kammergerichts Berlin ist ein wichtiger Sieg für die Nutzerrechte im digitalen Raum. Es stellt sicher, dass die im DSA verankerten Schutzmechanismen nicht durch formalistische Hürden der Plattformen unterlaufen werden.
Wurden auch Sie Opfer von Rechtsverletzungen im Internet, sei es durch Hassrede, falsche Tatsachenbehauptungen oder Urheberrechtsverletzungen? Die Kanzlei Kramarz steht Ihnen mit 15 Jahren Erfahrung im Urheber- und Medienrecht sowie im IT-Recht zur Seite. Wir helfen Ihnen, Ihre Rechte gegenüber Online-Plattformen effektiv durchzusetzen.
Nutzen Sie unsere kostenlose telefonische Erstberatung, um Ihren Fall zu schildern. Sie erreichen uns unter 06151-2768227, per E-Mail an anfrage@kanzlei-kramarz.de oder über unser Kontaktformular auf kanzlei-kramarz.de/kontakt.
Muss ich das offizielle Meldeformular einer Plattform nutzen, um Inhalte nach dem DSA zu melden?
Nein. Laut einer Entscheidung des Kammergerichts Berlin (Az. 10 W 70/25) sind Nutzer nicht gezwungen, das von der Plattform eingerichtete Verfahren zu nutzen. Auch eine Meldung per E-Mail oder durch einen Anwalt ist zulässig. Bei Fragen hierzu berät Sie die Kanzlei Kramarz gerne.
Was hat das Kammergericht Berlin genau entschieden?
Das Gericht hat entschieden, dass Artikel 16 des Digital Services Act eine Pflicht für Plattformen begründet, ein Meldesystem bereitzustellen, aber keine Pflicht für Nutzer, dieses ausschließlich zu verwenden. Die Wahl des Meldewegs liegt beim Nutzer, um dessen Rechte zu wahren.
Welche Risiken bestehen, wenn ich eine E-Mail statt des Formulars sende?
Sie tragen das Risiko, dass Ihre Meldung nicht "ausreichend präzise und hinreichend begründet" ist. Die Meldung muss der Plattform alle nötigen Informationen liefern, damit diese die Rechtswidrigkeit einfach erkennen kann. Im Zweifel ist ein anwaltliches Schreiben sicherer. Eine kostenlose telefonische Erstberatung erhalten Sie bei der Kanzlei Kramarz (Tel: 06151-2768227).
Wie kann die Kanzlei Kramarz bei Problemen mit Online-Plattformen helfen?
Rechtsanwalt Christian Kramarz, LL.M., Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht sowie für IT-Recht, hilft Ihnen bei der Formulierung rechtssicherer Meldungen, setzt Ihre Ansprüche auf Löschung oder Unterlassung durch und vertritt Ihre Interessen konsequent gegenüber den Plattformen. Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Erstberatung via anfrage@kanzlei-kramarz.de.