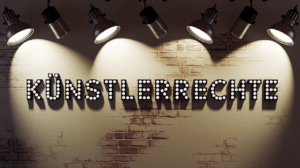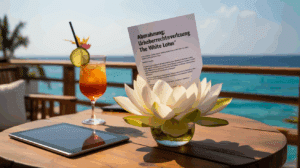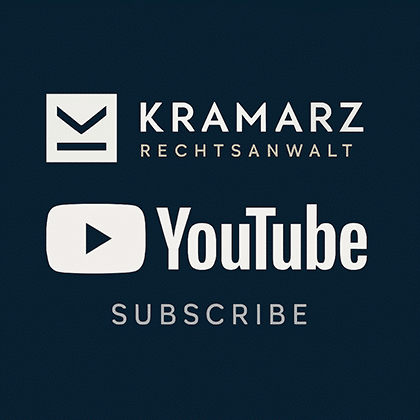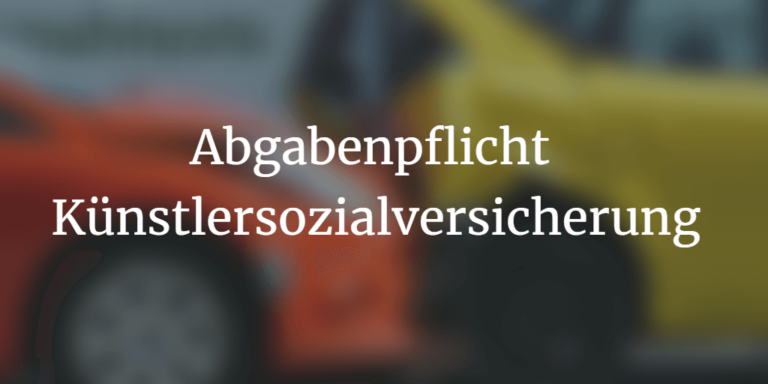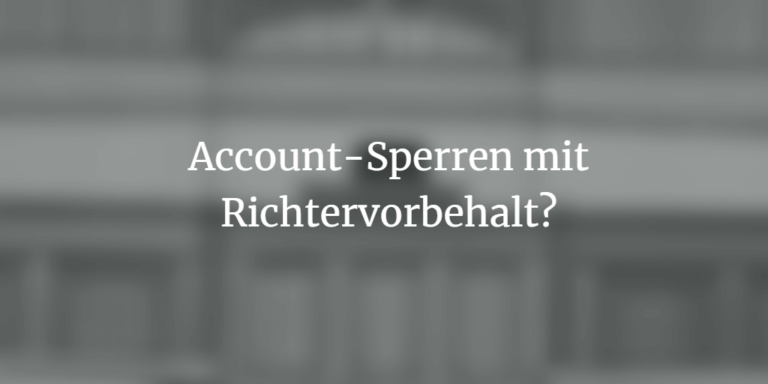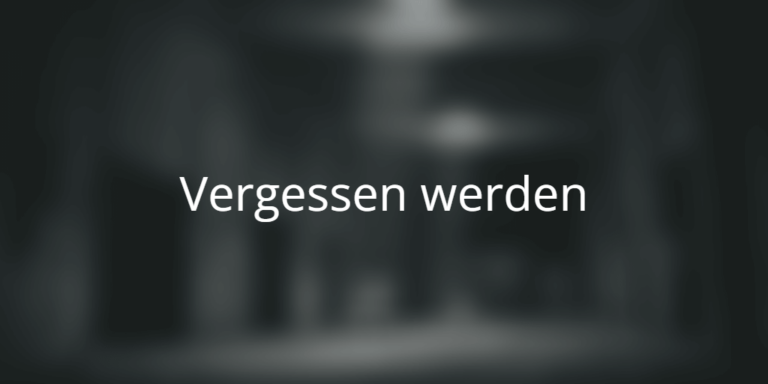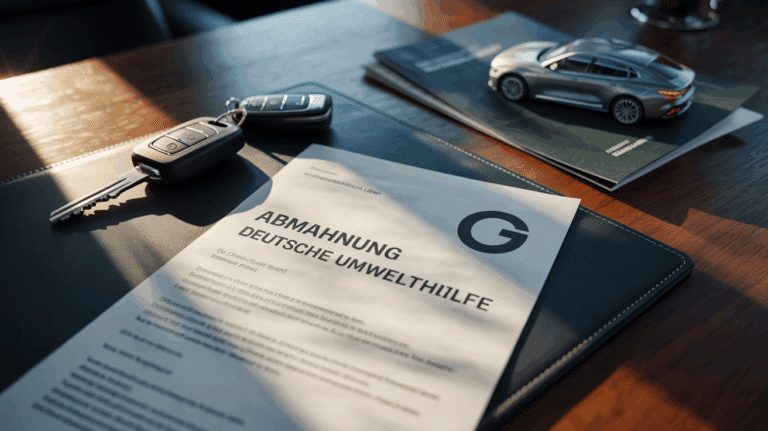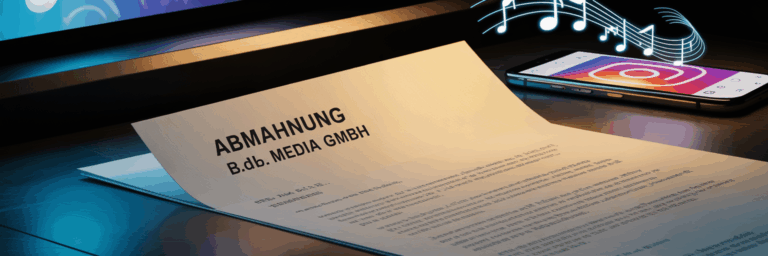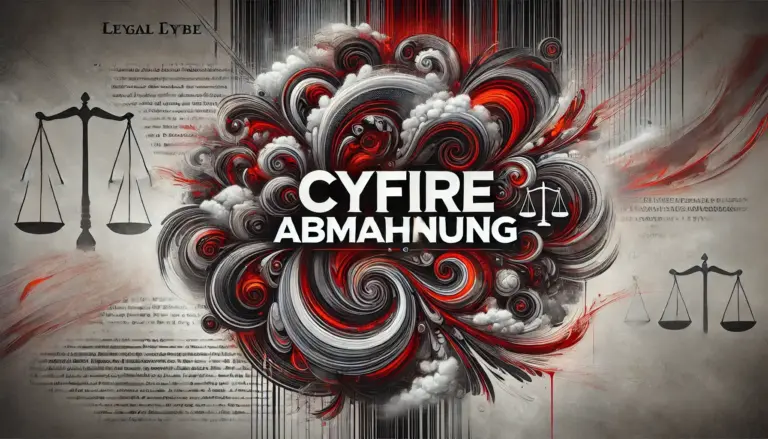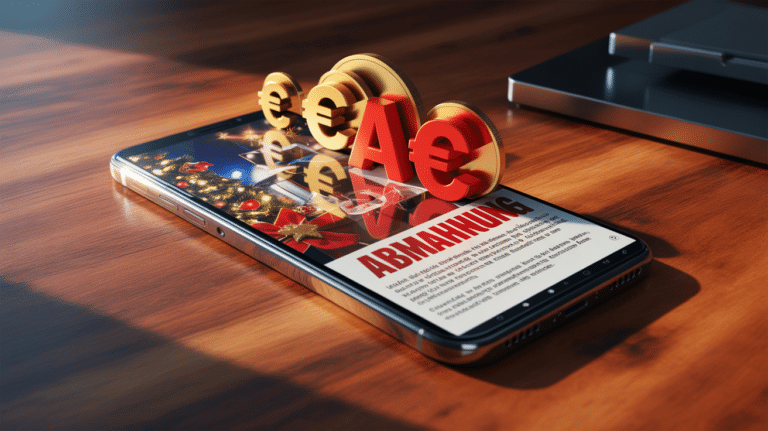Die Welt der künstlichen Intelligenz (KI) entwickelt sich rasant. Bildgeneratoren wie Midjourney oder Stability AI erstellen auf Knopfdruck beeindruckende Kunstwerke, und Sprachmodelle wie ChatGPT formulieren komplexe Texte. Doch diese technologische Revolution wirft eine entscheidende rechtliche Frage auf: Wem gehört die digitale Kunst, und dürfen KI-Systeme einfach mit urheberrechtlich geschützten Werken aus dem Internet trainiert werden?
Zwei parallel laufende, bedeutende Gerichtsverfahren aus den USA bringen nun Licht ins Dunkel und zeigen die tiefen Gräben zwischen dem US-amerikanischen und dem europäischen Rechtsverständnis auf. Als Experte für Urheber- und Medienrecht beleuchtet die Kanzlei Kramarz die Hintergründe und erklärt, was diese Entwicklungen für Kreative und Unternehmen in Deutschland bedeuten.
Schauplatz Kalifornien: Zwei Fronten im Kampf um das Urheberrecht
Vor dem U.S. District Court for the Northern District of California werden derzeit zwei separate, aber im Kern verwandte Schlachten geschlagen:
Der Fall der Künstler: Andersen v. Stability AI et al.
Hier klagen bildende Künstler, darunter Sarah Andersen, gegen die Macher populärer KI-Bildgeneratoren. Der Vorwurf: Die Unternehmen hätten Abermillionen urheberrechtlich geschützter Bilder ohne Erlaubnis aus dem Internet gesammelt, um damit ihre kommerziellen KI-Modelle zu trainieren. Das Gericht ließ in einer ersten Entscheidung den zentralen Vorwurf der direkten Urheberrechtsverletzung für das weitere Verfahren zu. Die Richter erkannten an, dass die unrechtmäßige Kopie der Werke in die Trainingsdatensätze eine Verletzung darstellen könnte.
Der Fall der Autoren: Tremblay v. OpenAI, Inc.
In diesem zweiten großen Verfahren klagen namhafte Autoren wie Paul Tremblay und Sarah Silverman gegen OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT. Ihr Vorwurf ist analog: Ihre Bücher seien ohne Erlaubnis als Teil des Trainingsdatensatzes „Books3“ zum Trainieren der Sprachmodelle verwendet worden. Auch hier geht es um die unrechtmäßige Vervielfältigung der Werke für den Trainingsprozess. Interessanterweise wies das Gericht hier Teile der Klage ab, die sich auf den Output der KI bezogen. Die Autoren konnten nicht nachweisen, dass ChatGPT Textpassagen generiert, die ihren Büchern „substanziell ähneln“. Der Kernvorwurf der rechtswidrigen Kopie für das Training blieb jedoch im Raum.
Das US-Konzept: Die alles entscheidende „Fair Use“-Doktrin
Beide KI-Unternehmen verteidigen sich mit einem Argument, das tief im US-Recht verwurzelt ist: der sogenannten „Fair Use“ (angemessene Verwendung) Doktrin. „Fair Use“ ist eine flexible Regelung, die es erlaubt, urheberrechtlich geschütztes Material unter bestimmten Umständen auch ohne Lizenz zu verwenden. Ein entscheidender Faktor ist dabei, ob die neue Nutzung „transformativ“ ist, also etwas grundlegend Neues mit einem anderen Zweck schafft.
Die KI-Firmen argumentieren, das Training eines Modells sei ein solcher transformativer Akt. Die KI würde die Werke nicht einfach nur kopieren, sondern daraus Muster lernen, um völlig neue, eigenständige Werke (Bilder oder Texte) zu generieren. Ob diese Argumentation vor Gericht Bestand haben wird, ist die Millionen-Dollar-Frage und könnte das Urheberrecht in den USA neu definieren.

Einschätzung für die deutsche und europäische Rechtslage: Kein „Fair Use“ bei uns
Hier liegt der entscheidende Unterschied zum deutschen und europäischen Recht. Eine allgemeine, flexible „Fair Use“-Doktrin existiert bei uns nicht. Das deutsche Urheberrechtsgesetz (UrhG) folgt einem strengeren Prinzip: Jede Nutzung eines geschützten Werkes ist grundsätzlich verboten, es sei denn, der Urheber hat sie erlaubt oder eine gesetzliche Ausnahme (eine sogenannte „Schranke“) greift.
Für das Training von KI ist vor allem eine neue Schrankenregelung relevant:
Die Lösung des deutschen Gesetzgebers: § 44b UrhG – Text und Data Mining
Mit der Umsetzung der EU-Urheberrechtsrichtlinie wurde der § 44b UrhG geschaffen. Diese Vorschrift erlaubt das sogenannte „Text und Data Mining“ (TDM), also die automatisierte Analyse großer Datenmengen – egal ob Text oder Bild –, um daraus Informationen zu gewinnen. Das Training einer KI fällt genau darunter.
Doch die Erlaubnis hat einen entscheidenden Haken für kommerzielle Anbieter: Rechteinhaber können der Nutzung ihrer Werke für kommerzielles TDM widersprechen. Dieser Widerspruch wird als „Nutzungsvorbehalt“ bezeichnet und muss in maschinenlesbarer Form erfolgen (z. B. in den Metadaten oder den Nutzungsbedingungen einer Webseite).
Prognose: Wie würden die Fälle in Deutschland entschieden?
Hätten die Klagen vor einem deutschen Gericht stattgefunden, wäre der Prüfungsmaßstab ein völlig anderer und deutlich konkreter. Die Richter würden nicht abstrakt über „transformative Nutzung“ urteilen, sondern ganz gezielt fragen:
- Haben die Künstler (im Fall Andersen) oder die Autoren bzw. deren Verlage (im Fall Tremblay) einen wirksamen Nutzungsvorbehalt nach § 44b Abs. 3 UrhG erklärt?
- War dieser Vorbehalt für die KI-Unternehmen maschinell erkennbar?
Hätten die Rechteinhaber einen solchen Vorbehalt platziert, wäre das kommerzielle Training der KI mit diesen Werken in Deutschland klar rechtswidrig. Die KI-Unternehmen hätten eine Lizenz erwerben müssen. Dies gilt für die Bilder der Künstler genauso wie für die Bücher der Autoren.
Fehlt ein solcher Vorbehalt, wäre das Training unter den Voraussetzungen des § 44b UrhG wahrscheinlich erlaubt. Das deutsche und europäische Recht gibt Urhebern somit ein starkes und klares Werkzeug an die Hand, um die Kontrolle über ihre Werke zu behalten – sie müssen es nur aktiv nutzen.
Fazit und Handlungsempfehlung
Die US-Verfahren zeigen, wie komplex die rechtliche Bewertung von KI weltweit ist. Während in den USA noch um die Grundfesten des „Fair Use“ gerungen wird, hat der europäische Gesetzgeber bereits klarere Regeln geschaffen. Kreative in Deutschland sind nicht schutzlos gestellt. Sie können und sollten von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, um die kommerzielle Verwertung ihrer Werke durch KI zu steuern.
Wenn Sie als Künstler, Autor, Verlag oder Fotograf unsicher sind, wie Sie Ihre Werke wirksam schützen können, oder als Unternehmen KI-Systeme rechtssicher nutzen möchten, ist eine fachkundige Beratung unerlässlich. Die Kanzlei Kramarz steht Ihnen mit 15 Jahren Erfahrung im Urheber- und Medienrecht zur Seite. Nutzen Sie unsere kostenlose telefonische Erstberatung, um Ihre Situation zu klären. Kontaktieren Sie uns unter kanzlei-kramarz.de/kontakt, per E-Mail an anfrage@kanzlei-kramarz.de oder telefonisch unter 06151-2768227.