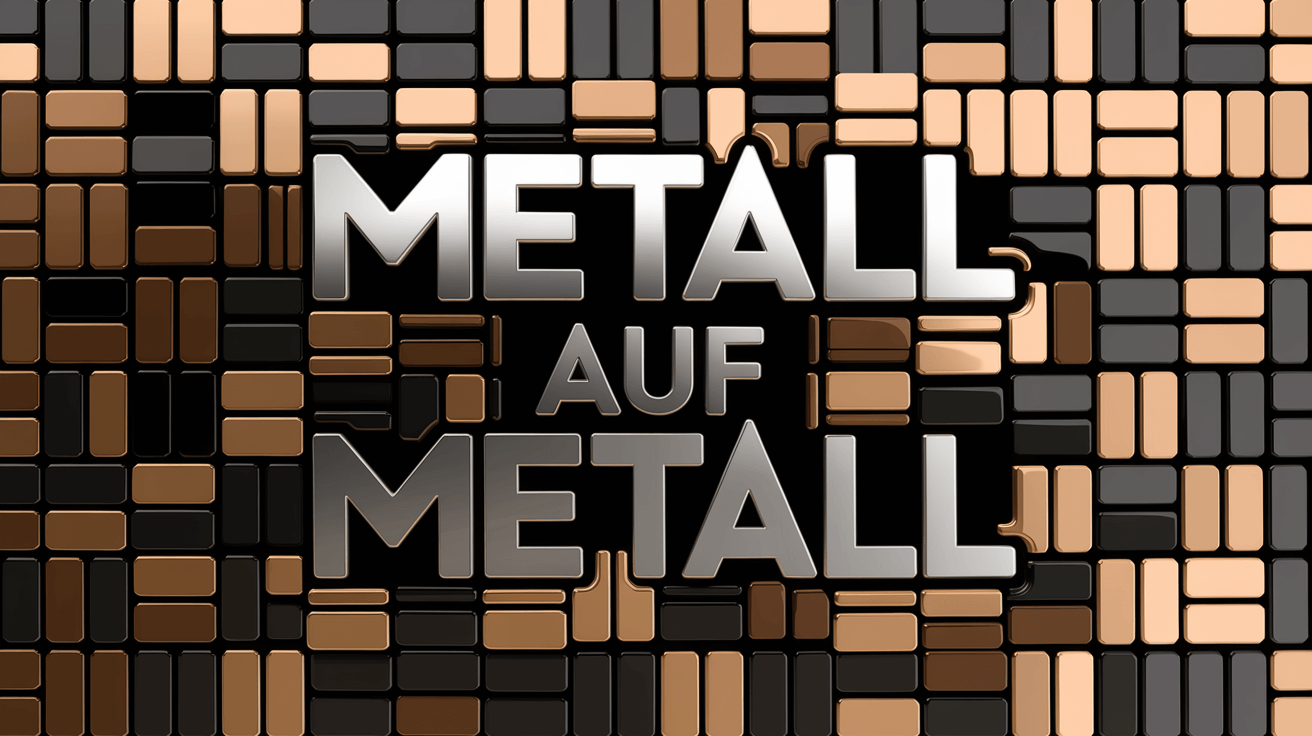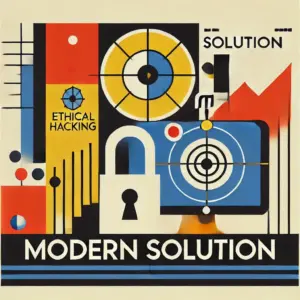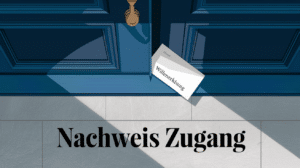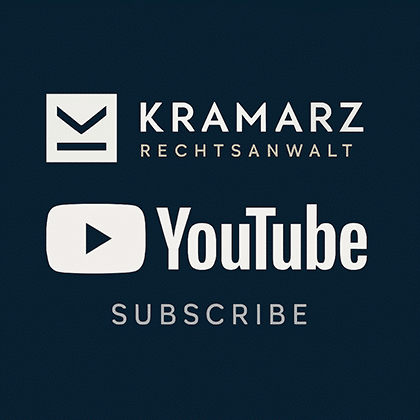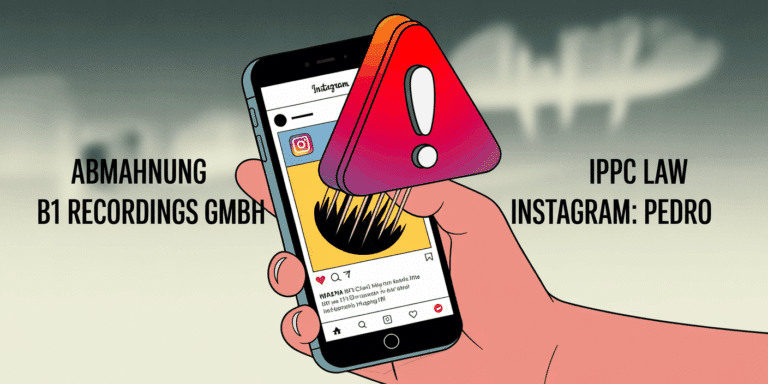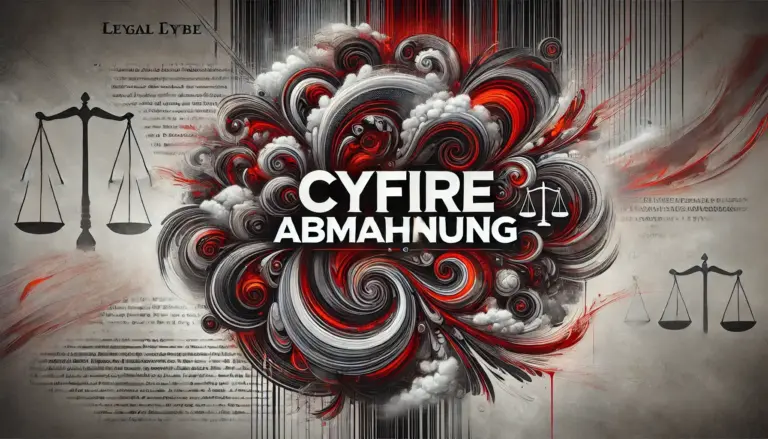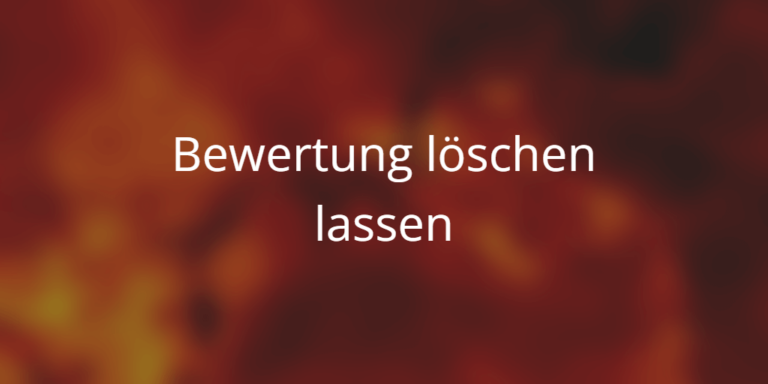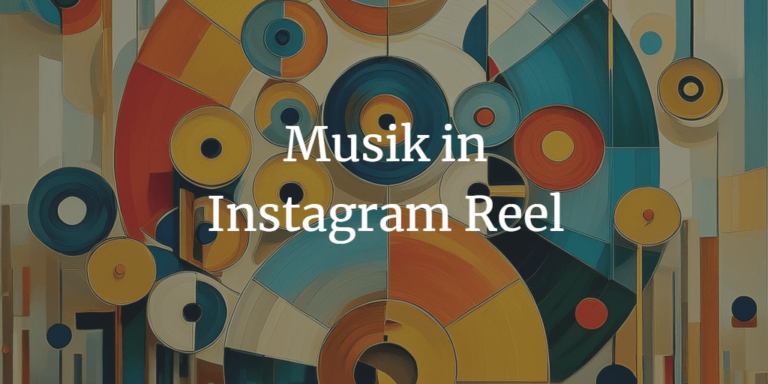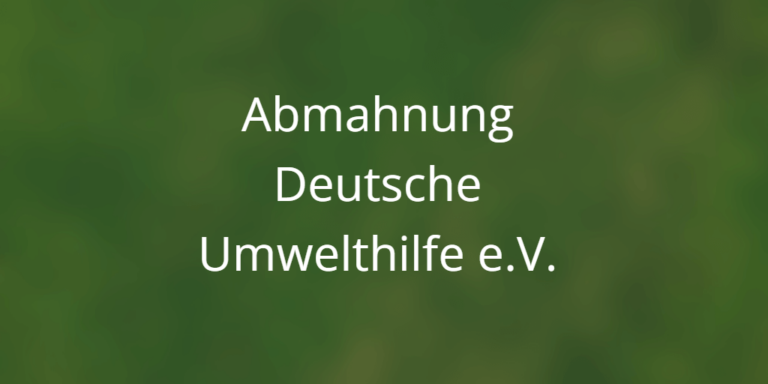Der EuGH steht erneut vor einer wegweisenden Entscheidung im Urheberrecht: Am 14. Januar 2025 fand die mündliche Verhandlung im Fall C-590/23 (Pelham II) statt, in dem es um die Auslegung der Pastiche-Schranke gemäß Art. 5 Abs. 3 lit. k InfoSoc-Richtlinie geht. Kern der Debatte ist die Frage, ob ein zweisekündiges Sample aus einem Tonträger unter die Pastiche-Ausnahme fällt. Hier die zentralen Erkenntnisse aus der Anhörung und ihre Bedeutung für die Praxis.
Hintergrund: Von Pelham I zu Pelham II
Bereits 2019 entschied der EuGH in Pelham I, dass selbst kurze Samples urheberrechtlich geschützt sind, sofern sie nicht „in einer veränderten, für das Ohr nicht erkennbaren Form“ verwendet werden (Rs. C-476/17). Nach der Rückverweisung an den BGH bestätigte dieser eine Urheberrechtsverletzung (I-ZR 115/16).
Mit der Umsetzung der Parodie-, Karikatur- und Pastiche-Schranke in deutsches Recht (§ 51a UrhG) ergab sich jedoch eine neue Rechtslage. Pelham II dreht sich nun um die Auslegung von „Pastiche“ – ein unbestimmter Rechtsbegriff, der bislang nicht EU-einheitlich definiert ist.
Streitpunkte: Wie definiert man „Pastiche“?
Deckmyn als Leitlinie?
Deutschland und die EU-Kommission plädierten für eine tripartite Auslegung analog zur Parodie-Entscheidung Deckmyn (Rs. C-201/13):
- Evokation: Das neue Werk muss das Original erkennbar aufgreifen.
- Unterscheidbarkeit: Es muss zugleich deutliche Unterschiede aufweisen.
- Künstlerische Auseinandersetzung: Statt Humor/Mockering (wie bei Parodie) genügt hier jede Form des „künstlerischen Dialogs“ – etwa Hommage, Stilimitation oder kritische Reflexion.
Die Kommission betonte, Pastiche sei als autonomer EU-Begriff zu verstehen, warnte aber vor einer zu engen Anlehnung an Parodie.
- Was ist „künstlerische Auseinandersetzung“?
Die Richter zeigten besonderes Interesse an der Konkretisierung dieses Kriteriums:
- Die Beklagten argumentierten, es reiche eine „Integration des Originals in etwas Neues“.
- Die Kläger forderten dagegen eine qualifizierte Auseinandersetzung, die über bloße Übernahme hinausgeht.
AG Emiliou hinterfragte, ob Gerichte künstlerische Intentionen bewerten dürfen – ein heikler Punkt, da Urheberrecht nicht Kunstqualität schützt, sondern Werkschöpfungen.
- US-Fair-Use-Vergleich
Mehrere Parteien zogen Parallelen zum US-amerikanischen Transformative-Use-Prinzip (vgl. Campbell v. Acuff-Rose). Ob der EuGH hier Anleihen nimmt, bleibt offen. Klar ist: Eine zu restriktive Auslegung könnte kreative Praktiken wie Sampling erheblich einschränken.
Praktische Relevanz für Rechtsanwälte
- Dreistufiger Test: Die Ausnahme darf weder die normale Verwertung des Originals beeinträchtigen noch unzumutbare Rechteeinbußen verursachen (Art. 5 Abs. 5 InfoSoc-Richtlinie).
- Beweislast: Künftig könnte die Intention des Nutzers eine Rolle spielen – etwa ob ein Sample bewusst zur Hommage eingesetzt wurde.
- Risikominimierung: Bei Sampling empfiehlt sich bereits jetzt, die „künstlerische Auseinandersetzung“ explizit zu dokumentieren.
Ausblick: Wird Pastiche zum „europäischen Fair Use“?
Die Entscheidung des EuGH könnte weit über Musik-Sampling hinauswirken – etwa auf Memes, Remix-Kultur oder AI-generierte Inhalte. Sollte der Gerichtshof eine offene Pastiche-Definition wählen, würde dies die Schranken des Urheberrechts spürbar erweitern.
Für Deutschland ist zudem die Interaktion mit Art. 17 DSM-Richtlinie relevant (Upload-Filter etc.), die in Teil II des Verfahrens behandelt wird. Hier fehlen jedoch noch detaillierte Einblicke.
Fazit
Pelham II zeigt: Das Spannungsfeld zwischen Urheberrechtsschutz und künstlerischer Freiheit bleibt dynamisch. Für Rechtsberater wird es entscheidend sein, die Auslegung der „künstlerischen Auseinandersetzung“ im Blick zu behalten – sei es bei Vertragsgestaltung, Lizenzierung oder Rechtsstreitigkeiten.
Der EuGH muss nun einen Balanceakt vollführen: einerseits Rechtssicherheit schaffen, andererseits flexibel genug bleiben, um künftige Kunstformen nicht zu blockieren. Die Entscheidung wird mit Spannung erwartet – nicht nur von Juristen, sondern auch von der Musik- und Kreativbranche.
Hinweis: Teil II der Anhörung (Interaktion mit Art. 17 DSM-Richtlinie) konnte aufgrund aktuell fehlender Informationen nicht vertieft werden. Wir halten Sie auf dem Laufenden.