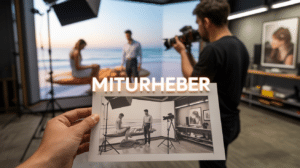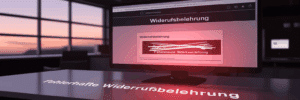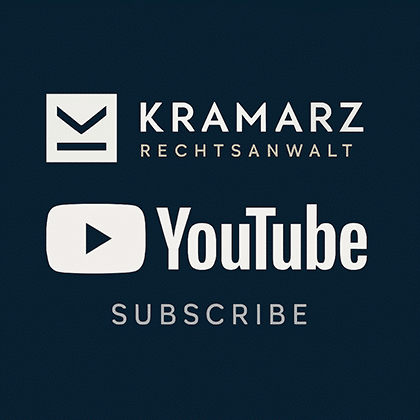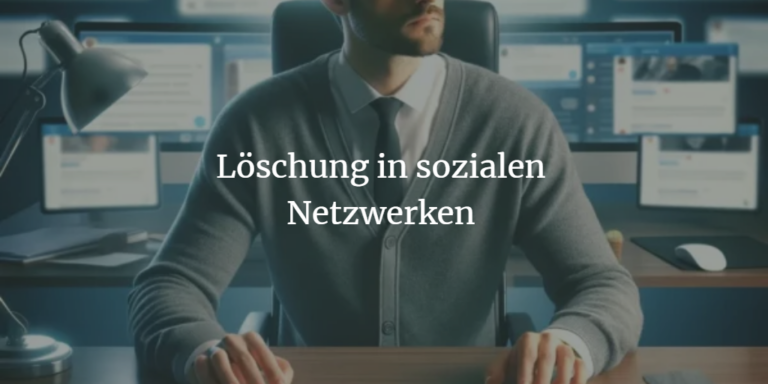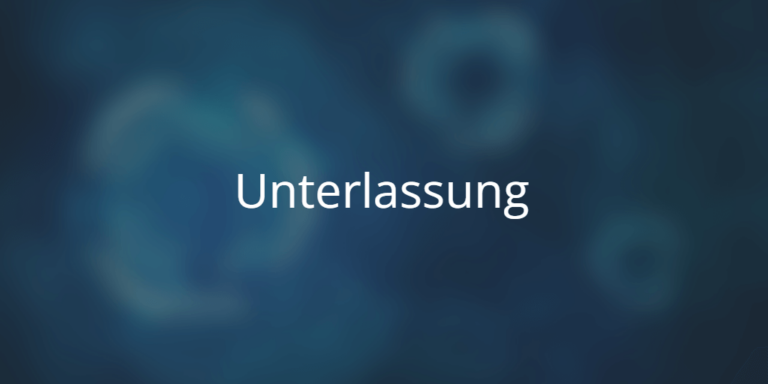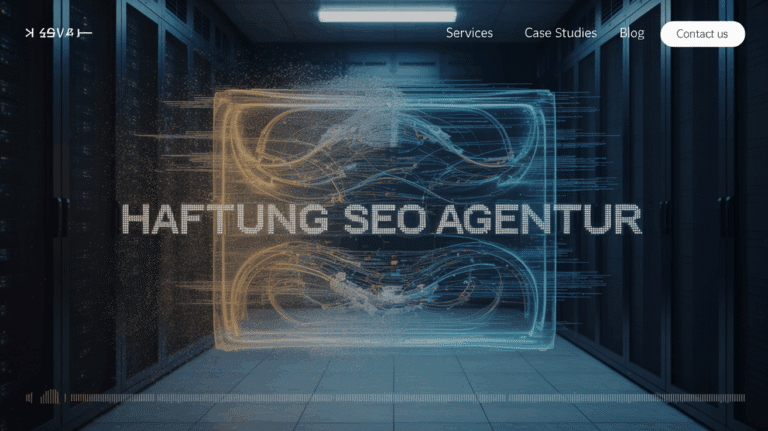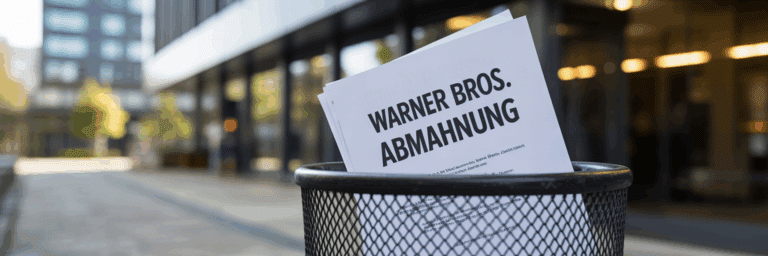Wurde ein urheberrechtlich geschütztes Werk wie eine Fotografie, ein Text oder eine Software ohne Erlaubnis genutzt, stellt sich für den Urheber die zentrale Frage nach dem Schadensersatz. Eine der wichtigsten und in der Praxis am häufigsten angewandten Methoden zur Berechnung dieses Schadens ist die sogenannte Lizenzanalogie. Doch was verbirgt sich genau dahinter und nach welchen Kriterien wird die Höhe des Anspruchs bemessen?
Als Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht mit über 15 Jahren Erfahrung in der Beratung von Kreativen und Unternehmen erläutert Rechtsanwalt Christian Kramarz, LL.M., die grundlegenden Prinzipien dieser Berechnungsmethode.
Die drei Wege der Schadensberechnung
Im deutschen Urheberrecht haben Rechteinhaber bei einer Verletzung ihrer Rechte grundsätzlich drei Möglichkeiten, ihren Schaden zu berechnen:
- Herausgabe des Verletzergewinns: Der Verletzer muss den Gewinn herausgeben, den er durch die rechtswidrige Nutzung des Werkes erzielt hat.
- Konkreter Schaden (inkl. entgangenem Gewinn): Der Urheber kann den Schaden ersetzt verlangen, der ihm konkret entstanden ist.
- Zahlung einer fiktiven Lizenzgebühr (Lizenzanalogie): Dies ist der häufigste Weg, da er für den Urheber am einfachsten zu handhaben ist.
Dieser Artikel konzentriert sich auf die dritte Methode, die Lizenzanalogie.
Das Kernprinzip der Lizenzanalogie: Der „Als-ob“-Vertrag
Die Lizenzanalogie basiert auf einer einfachen, aber wirkungsvollen Fiktion. Es wird die Frage gestellt: „Was hätten vernünftige Vertragsparteien als angemessene Vergütung vereinbart, wenn sie vor der Nutzung einen ordnungsgemäßen Lizenzvertrag geschlossen hätten?“
Der Verletzer wird also so behandelt, als hätte er eine Lizenz erworben. Er soll für die unrechtmäßige Nutzung nicht besser, aber auch nicht schlechter gestellt werden als ein redlicher Lizenznehmer. Entscheidend ist die Ermittlung des objektiven Werts der Benutzungsberechtigung zum Zeitpunkt der Verletzungshandlung. Ob der Verletzer persönlich bereit gewesen wäre, eine solche Gebühr zu zahlen, spielt dabei keine Rolle.
Welche Faktoren bestimmen die Höhe der fiktiven Lizenzgebühr?
Die Ermittlung der angemessenen Lizenzgebühr ist keine exakte Wissenschaft, sondern eine Schätzung durch das Gericht gemäß § 287 ZPO. Die Gerichte berücksichtigen dabei eine Vielzahl von Faktoren, um zu einem fairen Ergebnis zu gelangen.
- Branchenübliche Vergütungssätze: Tarife und Honorarempfehlungen von Verwertungsgesellschaften oder Berufsverbänden (z. B. die MFM-Tabelle für Fotografien) können als Anhaltspunkt dienen. Sie sind jedoch nicht schematisch anzuwenden, insbesondere wenn es sich um Werke von Amateuren oder um spezielle Nutzungsarten handelt. Neben allgemeinen Tarifen gibt es für spezielle Bereiche wie die Musiknutzung besondere Erfahrungssätze, beispielsweise die des Deutschen Musikverleger-Verbandes (DMV), die ebenfalls zur Orientierung herangezogen werden können, wie in unserem weiterführenden Artikel zur unlizenzierten Musik und Schadensersatz erläutert wird. Wie Gerichte diese Faktoren im konkreten Fall einer Bildrechtsverletzung anwenden, zeigt beispielhaft eine Entscheidung des OLG Köln, die wir in unserem Beitrag zur Berechnung von Schadensersatz bei Bildrechtsverletzungen analysiert haben.
- Art, Qualität und Umfang des Werkes: Ein professionelles, aufwendig inszeniertes Foto hat einen höheren Wert als ein einfacher Schnappschuss. Die Originalität und Gestaltungshöhe fließen maßgeblich in die Bewertung ein.
- Intensität und Dauer der Nutzung: Wie lange und wie prominent wurde das Werk genutzt? Eine kurze Nutzung auf einer Unterseite einer kleinen Webseite wird anders bewertet als die dauerhafte Verwendung auf der Startseite eines großen Online-Shops.
- Art und Umfang der Lizenz: Wäre eine ausschließliche oder eine einfache Lizenz angemessen gewesen? Wäre die Nutzung zeitlich oder räumlich beschränkt worden? Diese Aspekte beeinflussen den Wert der Nutzungserlaubnis.
- Wirtschaftliche Bedeutung und Gewinnaussichten: Der wirtschaftliche Wert der Nutzung ist ebenfalls relevant. Vernünftige Vertragspartner würden bei ihren Verhandlungen auch die branchenübliche Umsatzrendite berücksichtigen. Ein Lizenznehmer wird in der Regel kein Entgelt vereinbaren, das seinen zu erwartenden Gewinn übersteigt.
- Bekanntheit des Urhebers und des Werkes: Der Ruf und die Bekanntheit des Urhebers oder des spezifischen Werkes können den Lizenzwert ebenfalls steigern.
Bei der Beurteilung dieser Faktoren verfügen die Gerichte über einen weiten Ermessensspielraum.
Sonderfall: 100 % Zuschlag bei fehlendem Urhebervermerk
Ein besonders häufiger Streitpunkt ist die unterlassene Nennung des Urhebers. Nach § 13 UrhG hat der Schöpfer eines Werkes das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft. Wird der Name des Fotografen oder Autors bei der Veröffentlichung weggelassen, stellt dies eine eigenständige Rechtsverletzung dar.
In der Rechtspraxis hat sich etabliert, den hierfür fälligen Schadensersatz in Form eines Zuschlags auf die fiktive Nutzungsgebühr zu bemessen. In der Regel wird hierfür ein Zuschlag von 100 % auf die ermittelte Lizenzgebühr als angemessen erachtet. Die fällige Lizenz verdoppelt sich in diesem Fall also.
Fazit und anwaltliche Empfehlung
Die Lizenzanalogie ist ein flexibles und etabliertes Instrument, um einen gerechten Ausgleich für die unberechtigte Nutzung kreativer Leistungen zu schaffen. Die Höhe der fiktiven Lizenzgebühr hängt jedoch stark von den Umständen des Einzelfalls ab und erfordert eine sorgfältige Argumentation unter Berücksichtigung der relevanten Faktoren.
Sowohl für Urheber, deren Rechte verletzt wurden, als auch für Nutzer, die mit Schadensersatzforderungen konfrontiert sind, ist eine fundierte rechtliche Beratung unerlässlich. Die Kanzlei Kramarz unterstützt Sie mit langjähriger Expertise im Urheberrecht bei der Durchsetzung oder der Abwehr von Ansprüchen.
Für eine erste Einschätzung Ihrer Situation bieten wir Ihnen eine kostenlose telefonische Erstberatung an. Kontaktieren Sie uns unverbindlich unter 06151-2768227, per E-Mail an anfrage@kanzlei-kramarz.de oder über unser Kontaktformular auf kanzlei-kramarz.de/kontakt. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Was genau ist die Lizenzanalogie?
Die Lizenzanalogie ist eine Methode zur Berechnung von Schadensersatz bei Urheberrechtsverletzungen. Dabei wird gefragt, welche Lizenzgebühr vernünftige Vertragspartner vereinbart hätten, wenn sie vor der Nutzung einen ordnungsgemäßen Vertrag geschlossen hätten. Ziel ist die Ermittlung des objektiven Werts der Nutzung. Für eine fachkundige Beratung steht Ihnen die Kanzlei Kramarz zur Verfügung.
Was ist der Unterschied zum Verletzergewinn?
Während die Lizenzanalogie eine fiktive, angemessene Vergütung für die Nutzung selbst festlegt, zielt die Herausgabe des Verletzergewinns darauf ab, den konkreten Gewinn abzuschöpfen, den der Verletzer durch die Rechtsverletzung erzielt hat. Bei der Berechnung des Verletzergewinns können in der Regel keine Fixkosten des Verletzers abgezogen werden, was ein wesentlicher Unterschied ist. Eine kostenlose telefonische Erstberatung erhalten Sie bei der Kanzlei Kramarz (Tel: 06151-2768227).
Gilt die Lizenzanalogie nur für professionelle Fotos?
Nein, die Lizenzanalogie gilt für alle Arten von urheberrechtlich geschützten Werken, also auch für einfache Lichtbilder (Schnappschüsse) nach § 72 UrhG. Die Qualität des Werkes – ob professionell oder amateurhaft – ist jedoch ein wichtiger Faktor, den die Gerichte bei der Schätzung der Höhe der angemessenen Lizenzgebühr berücksichtigen. Im Zweifel beraten wir Sie gerne: anfrage@kanzlei-kramarz.de.
Was bedeutet der 100%-Zuschlag für fehlende Urhebernennung?
Das Urheberpersönlichkeitsrecht (§ 13 UrhG) gibt dem Urheber das Recht, als solcher genannt zu werden. Wird diese Nennung unterlassen, stellt dies eine separate Rechtsverletzung dar. Gerichte bemessen den dafür fälligen Schadensersatz oft durch einen Aufschlag von 100% auf die für die eigentliche Nutzung ermittelte fiktive Lizenzgebühr. Dadurch verdoppelt sich der Schadensersatzanspruch. Für eine umfassende Beratung zu Ihren Rechten besuchen Sie uns auf kanzlei-kramarz.de.